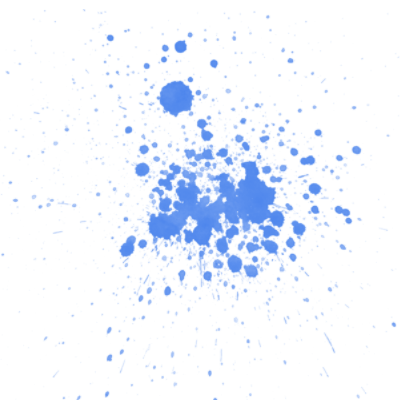"Vom Werden"

Katalog 1995 - vergriffen
Bilder auf Leinwand und Papier aus den Jahren 1993 - 1995
Texte: Willy Athenstädt, Kunsthalle Bremen
Hanns Herrmann Lagemann
"Vom Werden"
Arbeiten des Malers Puck Steinbrecher
Entstehung und Verstehen
- Steinbrecher arbeitet in Acryl auf Leinwand, bis zu etwa 60 x 50 cm auch auf Papier. Offensichtlich ist eine souveräne Maltechnik, die, der künstlerischen Aussage untergeordnet, bewußt eingesetzt und sorgfältig durchgehalten wird. So steht das im strengen Sinne malerische Element im Vordergrund, Vor allem aber bei älteren Arbeiten größeren Formats lassen geringe Beimengungen von Sand eine Art Mischtechnik entstehen; auch begleiten oft einzelne mit schwarzer oder weißer Ölkreide gezogene Linien die eigentliche malerische Arbeit. Die kleinsten Bilder beginnen bei etwa 27 x 25 cm, einige, aus jüngerer Zeit, überschreiten das Format 180 x 160 cm; fast alle sind nahezu quadratisch. Dieses Seitenverhältnis verlassen nur wenige Arbeiten: einige größere Querformate, aus zwei oder drei hochformatigen Leinwänden ineinander übergehend gearbeitet und engfugig zusammengesetzt ("Im Werden", Abb. 9); ein Bildvorschlag für eine Kirchengemeinde in der Form des Buchstaben "T", von etwa 150 cm Höhe und oben 130 bzw. unten 100 cm Breite ("Kreuzbild", Abb. 16); eine Reihe jüngerer Bilder ("Dialog"), die aus zwei für sich gearbeiteten, jedoch korrespondierenden TeilBildern eher kleiner Abmessung bestehen: An ein fast quadratisches Hochformat ist rechts ein schmales Hochformat angesetzt (z. B. "Großer Dialog" und "WasserDialog", Abb. 17 und 18); ebenfalls aus jüngster Zeit mehrere große, schmale Hochformate, die sich auch farblich von anderen Werken unterscheiden (s. unten) sowie einige bemalte Säulen und Pyramiden unterschiedlicher Größe und Form, die den experimentellen, aber dann nicht weiter verfolgten Schritt in die dritte Dimension vollziehen. Viele Bilder Steinbrechers zeigen etwa vier oder fünf Farbflächen fast immer unregelmäßiger Formen. Seit etwa 1994 hat es einige wenige Versuche mit streng gegeneinander gesetzten Rechtecken gegeben ("Ordnung 1 und 11", Abb. 14 und 15). Noch ist nicht klar, ob sich hier eine neue Formensprache ankündigt. Während in der Anfangszeit stille Farben wie Weiß, Grau und Blau, bisweilen Ocker die Palette dominierten, so sind inzwischen grüne, gelbe, rote Töne, sogar ein kräftiges Orange hinzugetreten. Seit langem finden sich fast immer kleinere schwarze Felder oder Bänder, die Flächen voneinander trennen und deren Farbwirkung verstärken. Ebenfalls seit etwa 1994 sind diese schwarzen Flächen in einigen Bildern vom Mittel zum Thema selbst geworden: Geheimnisvolle, kantig begrenzte schwarze Formen stehen, archaischen Chiffren gleich, vor einem Hintergrund aus verschiedenen Weißtönen ("Zeichen 1, 11, Ill", Abb. 34, 35, 36). Diesen Ansatz hat Steinbrecher zuletzt in den schon erwähnten großen, schmalen Hochformaten weiter verfolgt ("Gefüge", Abb. 12). Die Anordnung der Flächen zueinander läßt nie daran zweifeln, daß der Plan des Bildes sorgfältig komponiert ist; auch sind die einzelnen Flächen in sich weitgehend monochrom. Das bestimmt den ersten Eindruck des Betrachters. Beim genaueren Hinsehen aber sieht man: Die Flächen selbst sind in kleinen Schattierungen und Nuancen sorgfältig durchgearbeitet. Die Farbe ist in vielen Schichten, in einem langen Prozeß des Entwerfens und des Verwerfens in das Bild getragen. Dennoch ist die Leuchtkraft auch zurückhaltender Farben immer ungebrochen. Auf diese Weise entsteht der Eindruck einer großen, ruhigen Bewegung. Assoziationen werden geweckt an Dünen, Wolken, Wellen und, wo die Bewegung heftiger und kleinräumiger wird, an Flammen, also an bewegte Instanzen der klassischen vier Elemente Erde, Luft, Wasser und Feuer. Landschaft und Bewegung bestimmen die Arbeit Steinbrechers.
- Wer die Arbeiten Steinbrechers in ihrer Entwicklung betrachtet, stellt tatsächlich fest, daß sie aus einer Form der Landschaft entstanden sind, die geprägt ist durch das Zusammentreffen von Meer, Land und Himmel. Die erwähnten schwarzen Felder und Bänder sind erst später hinzugetreten als Elemente einer immer freieren Interpretation des ursprünglichen Gegenstandes seiner Bilder, wie sich auch die Farbe von ihrem natürlichen Vorbild gelöst hat. Daß aber die Formen immer noch die der Wolken, der Wollen und der Dünen sind, ist eine der Konstanten in seinem Werk. "Werdegang", Abb. 10, obwohl aus jüngster Zeit, zeigt diese Beobachtung deutlich. Die gesamte rechte Hälfte des Bildes wird dominiert von einem für sich betrachtet geradezu naturalistischen Lichtund Schattenspiel in einer Regenwolke (Nimbus). Nach links löst sich die Darstellung in einem tiefen Blau auf, in das von oben wiederum die Form einer scharf konturierten KumulusWolke ragt. Links unten werden diese Motive noch einmal aufgenommen in der Verbindung einer feinen Schattierung mit einer scharfen, gezackten Kante nach rechts. Eine größere und zwei kleinere Spuren von Ocker mag man, zumal sich die Farbe als Schatten in die Regenwolke hineinzieht, als abendliches oder gewittriges Licht oder als Reflex der Erde interpretieren oder sie einfach als gelungenes Spiel mit der Farbe sehen was bleibt, ist die Überführung des Bildes einer Wolkenlandschaft zum abstrakten Bild ohne eigentlichen Gegenstand. Die erwähnte schwarze Fläche hat sich hier zurückgezogen in die Form winziger Spuren an der Peripherie, der Mitte des oberen und des unteren Bildrandes. Das zeigt, schon fast selbstironisch, die konservative Arbeitsweise Steinbrechers, die Neues erst nach reiflichem Überlegen und Abwägen integriert und an Bewährtem lange festhält: Die schwarze Fläche wird, selbst wenn sie vielleicht nicht mehr unbedingt gebraucht würde (aber wer will das behaupten?), nicht gleich fallengelassen, sondern bleibt als Mittel erhalten, um reaktiviert werden zu können, wenn sie als Mittel wieder benötigt wird. Auch in dem Bild "Ursprung", Abb. 1, zeigt sich unverkennbar die Herkunft aus der (Dünen)landschaft. Interessant ist hier vor allem der Verlauf zum Rande hin: Unten, links und an einem Teil des oberen Randes löst sich die Farbe in das Weiß des Untergrundes auf. Bei den Bildern "Große Entfaltung 1, 11, Ill", Abb. 4, 5, 6, machen wir eine ähnliche Beobachtung. Darüber könnte man achtlos hinweggehen, gäbe es nicht eine scheinbar ähnliche Erscheinung in manchen frühen Bildern Steinbrechers: In ihnen hat er bisweilen den Rahmen in das Bild hinein verlegt, indem er den Rand wenige Zentimeter breit übermalte, exakt abgegrenzt, in lasierendem Weiß, das die Farbe durchscheinen ließ. So bleibt offen, ob das Bild den Rahmen aufsaugt oder ob der Rahmen in das Bild eindringt. Welche Absicht auch immer diesem Rahmen zugrunde gelegen hat seine Wirkung ist offensichtlich. Er dämpft den Aufprall des Bildes auf seine Umgebung. Er verhindert die Frage, wie der Inhalt des Bildes sich jenseits dessen Randes fortsetzen könnte. Er ist wie ein Ausrufezeichen hinter dem Satz: Das Bild ist fertig. Wo das Bild aber ohnehin nur den Teil eines größeren Ganzen darstellt und Teil eines größeren Ganzen ist, muß nicht der Eindruck erweckt werden, das Bild reiche nur bis zu seinem Rahmen. Der Rahmen war genau dieser Versuch, das Bild auf sein physisches Format zurückzudrängen. Da sich dieses Mittel als wenig tauglich erwies, ging Steinbrecher zeitweise einen anderen Weg: Er malte auf Stelen, Säulen oder Pyramiden, deren Oberflächen, da in sich selbst geschlossen, in sich selbst zurückkehrten. Auf diese Weise vermied er es, Anfang oder Ende zu definieren. Der Rahmen als solcher wurde überflüssig. Auch in den oben erwähnten jüngeren Werken (Abb. 1, 4, 5, 6) legt der Verlauf der Farbe zum Rande hin eine gewisse Distanz zwischen die Fläche des Bildes und die umgebende Welt. Doch anders als bei einem Rahmen ist das hier keine exakte, rechteckige, geradlinige Begrenzung. Hier steht kein Ausrufezeichen, hier stehen drei Punkte: Ende offen. Hier äußert sich hinter dem bewußten Verharren innerhalb der räumlichen Grenze der Anspruch auf ein größeres Territorium. Wenn das Bild aber über seinen Rahmen hinausreicht, dann kann man es auch weit innerhalb des Rahmens enden lassen. Daher wäre das Bild also nicht unfertig, sondern nur unabgeschlossen. Diese Erscheinung ist durchaus nichts Neues oder irgendwie Ungewöhnliches. Der Anspruch, alles sagen zu wollen, verhindert, wenn er durchgesetzt wird, die NeuEntstehung des Kunstwerkes im Kopf des Betrachters. Er hat etwas besserwisserisch Entmündigendes, das die Freiheit der Gedanken beschneidet. Die Offenheit aber, der Verzicht darauf, alles sagen zu wollen, ist wesentlicher Bestandteil jedes Kunstwerkes. So läßt eine Erzählung einen Vorgang beginnen und enden, und jedermann ist klar: Bevor sie beginnt, ist etwas geschehen, und nachdem sie geendet hat, wird sich das Geschehen fortsetzen. Die Erzählung komprimiert ein Stück Verlauf der Welt auf wenige Orte, wenige Personen, auf einen kurzen Moment, und doch ist in diesem Moment alles enthalten, was das Verständnis des gesamten Geschehens erfordert. Schon jedes von uns verwendete Wort steht ja nicht für sich selbst, sondern für einen gedanklichen Inhalt, seinen Begriff. Der faßt zusammen, steht für eine Vielzahl von Einzeldingen und läßt individuelle Ausprägungen weg. Das Wort "Baum" bezeichnet das Abstraktum eines Gegenstandes; indem es rein gar nichts aussagt über die Größe des bezeichneten Gegenstandes, indem es eine Vielzahl von Formen, Farben und Umgebungen offenläßt, abstrahiert es von zufälligen, meist unerheblichen Einzelheiten. So wird (sprachliche) Kommunikation erst möglich. Jedes dieser Beispiele zeigt: Durch gezielte Unabgeschlossenheit entsteht jenes Gleichgewicht zwischen der Genauigkeit der Aussage selbst und ihrer Offenheit für Interpretation, die das Kunstwerk in seiner individuellen Aufnahme durch den einzelnen Betrachter, den einzelnen Zuhörer oder den einzelnen Leser jedes Mal neu entstehen läßt.
- Eine andere Art von Unabgeschlossenheit, auf verblüffend neue formale Weise, ist Steinbrecher mit seinen "Dialog" betitelten Bildern gelungen (Abb, 1722). Er fügt einer Darstellung einen Ausschnitt ihrer selbst hinzu. Für den Menschen noch des Mittelalters gab es schon aus physikalischen Gründen nur eine Sicht der Welt: die, wie sie die eigenen Augen vermittelten, an dem Ort, an dem man sich in der Regel ein ganzes Leben lang aufhielt und an dem und um den herum mit der Geschwindigkeit des Fußgängers bewegte. Heute erscheint völlig selbstverständlich, daß die Welt nicht in der Sicht des Auges betrachtet werden muß, sondern daß dem Auge, je nach Erkenntnisinteresse, irgend etwas von einem Rasterelektronenmikroskop bis hin zu einer Satellitenkamera vorgeschaltet sein kann. ZoomObjektive sind Bestandteil von Billigkameras geworden. Die Manipulierbarkeit des Bildausschnittes erregt kein Erstaunen mehr. Auch in den "Dialog-Bildern" scheint das Mittel der Ausschnittvergrößerung eingesetzt zu sein. Aber Steinbrecher kopiert nicht die Technik der Standortveränderung, er spielt nur mit der Sichtweise des Betrachters. Denn wer sich auf die Suche nach der Stelle des größeren Teilbildes begibt, die in dem schmalen, kleineren rechten Teil vergrößert zu sein scheint, wird diese Stelle nicht finden. Es gibt sie nicht. Das kleine Bild kann für sich stehen, genauso wie das größere. Auch ist das kleinere Bild im größeren nicht als Muster wörtlich enthalten. Aber es greift dessen Motiv und dessen Farbmaterial auf und stellt so einen zwingenden inneren Zusammenhang her. Es ist eine zweite Stimme zum gleichen Thema so entsteht der "Dialog". Wenn aber der Schritt des Sehens und Interpretierens vom Bild zum Teilbild möglich ist, dann liegt die Frage nahe, als wessen Teil das Bild selbst zu sehen ist. So wird der Aspekt der Unabgeschlossenheit auf geradezu raffinierte Weise angedeutet. Das Bild stellt sich selbst gleichrangig neben seinen Gegenstand, läßt aber zugleich offen, welchen Aspekt es berücksichtigt und welchen es wegläßt. Es wird zur Interpretation seiner selbst, und weil diese Zirkelhaftigkeit die Gesetze der Logik verläßt, verläßt das Kunstwerk ganz bewußt die Grenzen der Rationalität und verzichtet auf die verbindliche Ausdeutung durch Dritte. (Das mag den Betrachter erfreuen, der anderes oder gar nichts in den Bildern sieht auch das ist legitim.) Diese Bilder geben nicht vor, vollständige Beschreibungen zu liefern. Sie machen uns klar, daß geschlossene Konzepte triviale Konzepte sind. Sie nehmen uns nicht das Denken ab, sondern fordern es heraus. Sie zeigen uns einen Teil der Wirklichkeit, abstrahieren ihn und überlassen es dann uns, unsere eigene Vorstellung von der Wahrheit zu formulieren. Abstrakte Bilder sind keine Abbilder von Wirklichkeit. Aber abstrakte Bilder, die ihren Ursprung nicht in einer Vorstellung von Wirklichkeit haben, sind bloße Dekoration und damit keine Kunst, sondern allenfalls Kunsthandwerk. Daß wir das aus den Bildern Puck Steinbrechers lernen können, zeigt uns, daß seine Bilder gute Bilder sind.
- Noch ein anderes Element bestimmt die Bilder Steinbrechers. Es ist, um es mit einem Wort aus der Musik zu bezeichnen, ihre Polyphonie. Natürlich könnte man statt von "Polyphonie" auch von "Parallelität der Gedanken" sprechen oder von "Vielschichtigkeit" oder was auch immer. Aber dann hätte man nur gesagt, daß hier vieles nebeneinander steht oder übereinander liegt, daß eine Schicht eine andere überdeckt, sie vielleicht auch hier und da freiläßt, daß eine obere Schicht auf eine untere antwortet, sie verstärkt oder ihr womöglich widerspricht. Natürlich finden wir auch das in den Bildern Puck Steinbrechers. Aber eine Beschreibung, die hier abbräche, hätte etwas Wesentliches nicht getroffen. Es wäre die Vielstimmigkeit seiner Bilder gewesen. Eine Stimme ist etwas Fließendes. Eine Stimme steht nicht da, an irgendeinem Ort, für eine gewisse, längere Zeit unverändert, sondern sie erhebt sich und sie vergeht, sie entsteht in der Zeit und sie vergeht mit der Zeit. Aber sie beansprucht diese Zeit für sich: Man kann sie nicht unterbrechen und sie wieder aufnehmen, ohne ihr ein Stück ihres Lebens zu nehmen. Bilder dagegen als bloße körperliche Objekte sind zuerst einmal etwas Statisches. Was den Vergleich mit der Stimme rechtfertigt, ist, daß der Gegenstand "Bild" für den Betrachter nur Ausgangspunkt sein kann. Das Ergebnis seiner Betrachtung aber ist, was in seinem Kopf erst entsteht: Es ist das Bild des Bildes, das Resultat eines Sehprozesses, das Ergebnis des Zusammenbringens des Bildinhalts mit den Erfahrungen, Erwartungen und den Sehgewohnheiten des Betrachters. Dieser Vorgang geschieht in der Zeit. Das verbindet ihn mit einer Stimme. Natürlich gilt das für Bilder ganz allgemein. Beim Betrachten der Bilder Steinbrechers wird diese an sich banale Erkenntnis plötzlich in einem besonderen Maße lebendig. Unser Blick wandert über das Bild, fängt sich an einer Grenze zwischen zwei Flächen, überwindet sie, wird dann aber doch in eine andere Richtung gelenkt, sieht die Strukturen innerhalb der Flächen, entdeckt Ähnlichkeiten, aber damit auch Variationen der Flächen zueinander, sieht Elemente des ihrem kontrapunktischen Bezug und läßt, im wahrsten Sinne des Wortes "bildlich" gesprochen, eben jenen polyphonen Klang entstehen. Und daß sich dann im Kopf des Betrachters etwas abgespielt haben muß, was der Kopf des Malers beim Malen die Hände des Malers hat wissen lassen, das zeigt sich auch darin, daß Steinbrecher, wenn er seine Bilder betitelt, ihnen fast immer Namen gibt, die nicht Gegenstände, sondern Vorgänge beschreiben: "Vom Wachsen und Werden" oder 1m Entstehen" etwa, "Aufruhr", "Entdeckung", "Befreiung", "Begegnung" alles Beispiele aus den späten 80er Jahren dann "Entwicklung", "Zwiegespräch" (1991) und jetzt: "Dialog", "Entfaltung", im Werden", "Geschehnis", "Prozeß", und noch einmal: "Begegnung". Selbst Titel wie "Momentanes" und "Ereignis" lassen keinen Zweifel an ihrer Herkunft aus einem Denken in zeitlichen Abläufen. Daß Steinbrecher eine Übersicht wie die hier vorliegende "Vom Werden" überschreibt, ist dann nur konsequent.
- Steinbrechers künstlerische Entwicklung ist vorsichtig tastend und daher sorgfältig vollzogen. Sie ist geprägt von den Skrupeln der handwerklichen Verantwortung. Nichts geschieht um des bloßen Effekts willen, und das ist es wohl, was dem Betrachter die Scheu davor nimmt, das hier und da noch gepflegte Vorurteil zu überwinden, schöne Bilder könnten keine guten Bilder sein. Die Reproduzierbarkeit der Resultate und die künstlerische Beherrschung der Effekte bewirken zugleich, daß Steinbrechers Bilder von konstanter Qualität sind. Nun wird aber der geniale Entwurf gern, wenn auch zu Unrecht, als nur singulär mögliches Ereignis gesehen. Der Wunsch des eiligen Kunstbetrachters ' , in fünfminütiger Besichtigung das Wesentliche des Besichtigten erfassen zu können, ist der Vater des Gedankens, die künstlerische Leistung konzentriere sich auf einen einzigen Moment der Genialität. Für die Realität der künstlerischen Produktion, die Schaffung handwerklicher Grundlagen, die langen Prozesse von Versuch und Irrtum, bleibt in einer solchen Vorstellung kein Platz. Daher wird konstante Qualität in der Regel verwechselt mit minderer Qualität. Das scheint Steinbrecher nicht zu stören. Er hat an seiner zögernden, Entwicklungen bewußt langsam vollziehenden Arbeitsweise stets festgehalten.
Hanns Hermann Lagemann, Juli 1995